Kriegsmaterial-Initiative: Warum Christen Ja stimmen sollten
1. Rüstung und Kriege in der heutigen Welt
Das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) liefert uns erschreckende Zahlen: Die Anzahl von bewaffneten lokalen oder regionalen Konflikten haben seit dem zweiten Weltkrieg stetig zugenommen, und zwar von 90 auf knapp 350 (offene und schwelende Konflikte zusammengezählt). Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Staaten sind zwar einige Stellvertreterkriege ebenfalls beigelegt worden. In den letzten zehn Jahren hat die Anzahl bewaffneter Konflikte jedoch wieder um 60 zugenommen.
Die Friedensdividende nach dem Ende des kalten Krieges hat nicht lange hingehalten. Statt längerfristige Abrüstung hat die Welt wieder hochgerüstet: In den letzten zehn Jahren haben die weltweiten Rüstungskäufe laut dem Sipri (Stockholm International Peace Research Institute) um 45 % auf 1464 Milliarden Dollar zugenommen.
Rüstung ist damit auch ein riesiges Geschäft geworden, und Lobbyorganisationen der Rüstungsindustrie sind nicht unbedingt am Frieden interessiert. Zahlreiche Berater von Präsident Bush, angefangen bei Vizepräsident Cheney, hatten starke Beziehungen zur amerikanischen Rüstungsindustrie und drängten zur Invasion des Irak.
Wir stellen heute fest, dass die noch herrschende Doktrin der Abschreckung durch Rüstung nur beschränkt gilt, nämlich in Bezug auf die grossen Blöcke und auf Atomwaffen. Das Internationale Konversionszentrum in Bonn (BICC) sagt, dass die Grösse des Militärapparates auch auf die Häufigkeit von Gewaltanwendungen, sowie auf interne und externe gewalttätige Konflikte ihren Einfluss hat. Rüstungstransfers wirken auf Konflikte wie Brandbeschleuniger. Ein ungebrochener Zustrom von ausländischen Waffen schürt die Gewalt und verzögert friedliche Lösungen.
Kleinwaffen wie Pistolen und Gewehre wirken besonders verheerend: Laut Amnesty International werden jeden Tag 1000 Menschen durch Handfeuerwaffen getötet, im Jahr also rund 365’000. Die Kontrolle der Weiterverbreitung der Kleinwaffen ist noch sehr schwach. Viele Länder, auch die Schweiz, weigern sich noch, das UNO-Firearms Protocol zu unterzeichnen, das den Handel mit Kleinwaffen wie auch den illegalen Weiterverkauf kontrollieren würde. So kommt es, dass nach Konflikten massenhaft Waffen unkontrolliert weiterverkauft oder weiterverwendet werden. Dies ist mit ein Grund, warum die Mordrate und die «zivile» Gewalt in Ländern mit postkonfliktuellen Phasen weltweit am höchsten ist, so zum Beispiel in El Salvador oder in Südafrika.
2. Die Auswirkungen von Waffenkäufen und Kriegen auf arme Länder und auf die Entwicklung
Aus der Sicht der internationalen Gerechtigkeit interessieren die Auswirkungen von Waffenkäufen und Kriegen auf arme Länder und auf die Entwicklung ganz besonders.
Zunächst gilt es festzuhalten, dass jeder Dollar, den ein armes Land für Waffenkäufe ausgibt, in den Bereichen Gesundheit und Bildung fehlt. Zahlreiche arme Länder geben noch immer mehr für Waffen aus als für Bildung oder Gesundheit. Rüstungsgüter verursachen zudem hohe Folgekosten für den Unterhalt.
Da die Korruption in vielen Ländern des Südens noch hoch ist, ist es für ausländische Waffenanbieter ein Leichtes, Regierungen für Waffenkäufe zu gewinnen.
Die Fähigkeiten armer Länder, Waffen zu kontrollieren, ist sehr klein. Und manche Länder foutieren sich um Nichtweitergabeklauseln bei Waffenkäufen, denn sie wissen, dass sie gar nicht dafür bestraft werden können. Die Diffusion von Waffen nährt somit lokale und regionale Konflikte. Der Zustrom von libyschen Waffen in die Konflikte von Liberia und Sierra Leone ist gut dokumentiert. Umgekehrt finden Waffen aus Kriegen auch den Weg in die Hände von Kriminellen, wie die Beispiele von Kolumbien und El Salvador zeigen. Die beiden Länder leiden bzw. litten unter Bürgerkriegen und sind heute die beiden Länder mit der höchsten Mordrate der Welt.
Viele Regierungen im Süden sind nicht demokratisch gewählt oder kontrolliert. Im Gegenteil, sie unterhalten einen polizeilichen oder militärischen Machtapparat, mit dem sie ihr Volk unterdrücken. Die Waffen dazu kommen aus dem Norden. Entwicklungsfeindliche Regierungen können sich damit an der Macht halten.
3. Krieg und Frieden in der Bibel
An dieser Stelle kann das Thema Krieg und Frieden in der Bibel kaum umfassend behandelt werden. Deshalb nur einige Anhaltspunkte dazu:
– Im Alten Testament führt das Volk Israel zahlreiche Kriege. Diese wurden oft von Gott direkt angeordnet. Manche wurden von Königen des Volkes Israel auf eigene Faust unternommen, was aber nicht immer gut herauskam. Insgesamt ging es bei den Kriegen darum, dass das Volk Gottes seinen vorgesehenen Platz einnehmen und Gott als sein Helfer erkannt werden sollte.
– Im Neuen Testament wird Gewalt durch Jesus abgelehnt. Er kommt nicht als der gewaltbereite, revolutionäre Anführer, als der er vom Volk Israel erwartet wurde. Und er setzt dem Knecht des Hohepriesters das Ohr wieder an, das ihm ein Begleiter Jesu mit dem Schwert abgeschlagen hatte. Danach meint Jesu: «Wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen.» (Mat. 26,52) Im Neuen Testament werden wir auch aufgefordert, Friedensstifter zu sein.(Mat. 5,9)
– Krieg an sich kann biblisch nicht neutral angesehen werden. Krieg ist in vielen Fällen die grösste Katastrophe, die ein Land erleben kann. Die Leiden sind unbeschreiblich, und viele Länder und Generationen sind danach traumatisiert, die Beziehungen zu den Nächsten oder zu anderen Ländern von Angst geprägt. Krieg widerspricht damit Gottes Wunsch nach Wohlergehen seiner Geschöpfe. Ausser der Krieg sei von Gott selber gewollt und angeordnet. Dies ist aber selten der Fall. Im ersten Weltkrieg haben alle Seiten behauptet, Gott sei mit ihnen. Ein vermeintlicher «Auftrag Gottes» ist deshalb mit grosser Vorsicht anzusehen. Es ist immer nach anderen, tiefer liegenden Motiven zu fragen, oder ob der «Auftrag Gottes» nur eine Projektion unserer Wünsche ist.
– Die Selbstverteidigung eines Volkes ist im Grunde legitim. Allerdings ist das Risiko gross, dass dieser Begriff bei Bedarf oder in grosser Angst sehr weit ausgelegt wird: Der erste Weltkrieg wurde als Präventivkrieg angefangen, und auch der Irakkrieg wurde als notwendiger Präventivschlag gegen die irakischen Massenvernichtungswaffen, die sich als nicht existent herausstellten, bezeichnet.
Im Zusammenhang mit den zunehmenden Konflikten und den verheerenden Auswirkungen müssen wir Christen uns mehr denn je die Frage stellen, ob und wem wir Waffen verkaufen sollen oder nicht. Da wir wissen, was Waffen heute anrichten, und da wir wissen, wer die Käufer unserer Waffen sind, und da wir wissen, was allenfalls mit diesen Waffen passieren könnte, haben wir eine Mitverantwortung, denn wir können bewusst entscheiden, ob wir die Waffen verkaufen und liefern wollen oder nicht. Wir können nicht mehr sagen, die Verantwortung für die Verwendung der Waffen liege beim Käufer. Damit gewinnt die Initiative für ein Waffenverbot eine grosse Bedeutung.
Wir können auch nicht sagen, wenn wir die Waffen nicht liefern, dann tut es jemand anderes. Gott verlangt, dass wir für unser eigenes Handeln Verantwortung übernehmen.
4. Die Schweiz als Waffenverkäufer
Die Schweiz hat im Jahr 2008 für 722 Millionen Franken Waffen an das Ausland verkauft. Gemessen an der Einwohnerzahl unseres Landes ist die Schweiz damit nach Israel die grösste Rüstungsexporteur der Welt. Die Mehrheit der Verkäufe ging an europäische Staaten. Der grösste Kunde allerdings war Pakistan, mit einem Kaufvolumen von 100 Millionen Franken. In den letzten zehn Jahren hat die Schweiz Waffen an etwa 100 Staaten geliefert, darunter auch Libyen, Simbabwe und Sudan.
In der Schweiz gibt es vier grössere Rüstungsfabriken: Die Ruag in Thun, die vor Allem Munition exportiert, die Mowag in Kreuzlingen (Schützenpanzer), die Rheinmetall Air Defence (frührere Contraves; Luftabwehrkanonen), und die Pilatus-Flugzeugwerke, die unter anderem Trainingsflugzeuge herstellt.
Fragwürdige Abnehmer
Die Liste der ethisch fragwürdigen Abnehmer und Verwendungen ist lang. Als Beispiele dienen Folgende:
– In den Siebziger Jahren war der korrupte Schah von Iran der Hauptkunde der Schweizer Waffenindustrie. Seine Waffen wurden aber auch später von den islamischen Revolutionären gebraucht und durch weitere Schweizer Waffen angereichert. Heute schützen Schweizer Luftabwehrkanonen die iranische Urananreicherungsanlage in Natanz.
– Die Schweizer Rüstungsindustrie hat sowohl den Iran wie den Irak während des ersten Golfkrieges, der eine Million Tote forderte, regelmässig ausgerüstet.
– Der chilenische Diktator Pinochet durfte die Mowag-Panzer in Lizenz bauen und beherrschte damit die eigene Bevölkerung.
– Zwischen 1985 und 1990 war die Türkei der Hauptabnehmer. Die Waffen wurden für den Unterdrückungskrieg gegen die Kurden gebraucht.
– In den Achtziger Jahren wurde Schweizer Munition und Teile für eine Giftgasfabrik an Gaddafis Libyen geliefert.
– Berühmtheit erlangten auch die Einsätze von Pilatus PC 7 und PC 9. In der Theorie werden sie als Trainingsflugzeuge verkauft. Doch in Militärkreisen ist weltweit bekannt, dass die Pilatus-Flugzeuge gute Bomber (gegen Bevölkerungen ohne Flugabwehr) sind und als solche verwendet werden, und es darf davon ausgegangen werden, dass auch die Pilatus-Hersteller wie auch die Bundesbehörden, die Kriegsmaterialexporte bewilligen, dies wissen. Ein französischer Bombenhersteller wirbt in seinen Promotionsfilmen mit diesen Flugzeugen, und Pilatus selber warb in den 80er-Jahren mit vielfältigen Bombenbefestigungs-Möglichkeiten für die Flugzeuge. So wurden sie in zahlreichen Fällen zur Machterhaltung von Diktatoren gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt, zum Beispiel in Guatemala, in Chiapas, in Burma, und auch im Irak, wo Hussein 5000 Menschen durch einen Giftgasangriff mit Pilatusflugzeugen umbringen liess.
– Und schliesslich war Botswana im Jahr 2004 der zweitgrösste Kunde der Schweiz. Im Jahr 2004 und 2005 kaufte das arme Land für 100 Millionen Franken Mowag-Panzer…
Gesetzliche Regelungen ausreichend?
Vertreter der Schweizer Rüstungsindustrie meinen, die heutigen gesetzlichen Regelungen stellen sicher, dass keine Waffen mehr in Krieg führende oder kriselnde Länder geliefert werden. Genügt dies?
– Als Beweis für die These wird das Ausfuhrmoratorium nach Pakistan vom Jahr 2006 angeführt. Doch die Waffen wurden dann im Jahr 2008 geliefert, obwohl die Atommacht Pakistan nach übereinstimmenden Analysen von Fachleuten am Rand des politischen Zusammenbruchs steht, mit der Gefahr, dass islamische Extremisten die Macht übernehmen.
– Im Jahr 2007 wurde eine Pilatus PC-9 als Trainingsflugzeug an den Tschad verkauft, obwohl der Staat gar keine anderen Militärflugzeuge besitzt, für die sie hätten trainieren können. Folglich setzte das Land das Flugzeug im Osten des Landes gegen Aufständische ein und bombardierte im Darfur ein Flüchtlingslager.
– Die Abnehmer von Schweizer Waffen waren im Jahr 2008, neben den Europäischen Staaten, auch Pakistan, Saudi-Arabien, VAE, Jordanien, Oman, Kasachstan, Niger und Kamerun. Also alles Staaten mit diktatorischen Zügen und massiven Menschenrechtsverletzungen.
– Schliesslich ist die Ruag der grösste europäische Munitionshersteller. Gleichzeitig ist die Ruag der neuntgrösste Lieferant an Schwarzafrika. Auf Grund der hohen Tötungsrate durch Kleinwaffen und der in Kapitel 1 und 2 genannten Kontrollmängel muss dieser Export als höchst problematisch bezeichnet werden.
Waffenexport widerspricht Entwicklungspolitik
Der Waffenexport der Schweiz läuft also zum Teil der schweizerischen Aussen- und Entwicklungspolitik zu wider. Diese nennt als Schwerpunkte die Förderung von Frieden und Menschenrechten. Wie wir sehen, werden auch heute noch zahlreiche Staaten beliefert, die die Menschenrechte mit Füssen treten. Durch die Lieferung von Kleinwaffen in afrikanische Staaten und von Pilatus-Flugzeugen an unterdrückende Staaten werden noch heute Friedensbemühungen hintertrieben. Nach dem Skandal im Tschad hat der Bundesrat Ende 2008 die Waffenausfuhrverordnung dahingehend ergänzt, dass neu auch bei Gefahr des Einsatzes gegen die eigene Bevölkerung zur Verweigerung einer Ausfuhrbewilligung führen. Die Pilatus-Werke versuchten Lobby gegen die Verschärfung zu machen, denn sie wollten nach China exportieren, obwohl Tibet heute in Gefahr ist.
Auch nach Inkrafttreten der neuen Verordnung gehen die problematischen Exporte weiter: Im Jahr 2009 wurden bereits zahlreiche Staaten beliefert, die im Afghanistankrieg involviert sind und dort die Schweizer Waffen verwenden. Auch Pakistan wird weiter beliefert, und vor Allem Saudi-Arabien, dessen Herrscher immer brutaler gegen die eigene Bevölkerung vorgehen. Problematisch ist zudem die Hochrüstung des Nahen Ostens, das zunehmend einem Pulverfass gleicht, und weiteren islamischen Staaten, die nicht vor Umstürzen gefeit sind.
5. Die Kriegsmaterial-Initiative
Inhalt
Inhaltlich will die Kriegsmaterial-Initiative die Ausfuhr von Kriegsmaterial verhindern. Was in der EU einheitlich Kriegsmaterial heisst, wird in der Schweizer Gesetzgebung in zwei Kategorien eingeteilt: Kriegsmaterial ist in der Schweiz nur Material, das ausschliesslich zu Kriegszwecken verwendet werden kann. Material hingegen, das auch zivil genutzt werden kann, wird «Besondere militärische Güter» genannt und deren Export wird von der Schweiz weniger streng gehandhabt. Darunter fallen auch die Pilatus-Flugzeuge, die damit problemloser exportiert werden können als analoge Flugzeuge in der EU. In der EU-Kriegsmaterialliste (Wassenaar-Vereinbarung) ist allerdings letztere Kategorie klar auch als Kriegsmaterial eingestuft.
Daneben existiert sowohl in der Schweiz wie auch in der EU die Dual-Use-Kategorie (die in der Wassenaar-Vereinbarung mit einer detaillierten Materialliste geregelt ist), die zivile Güter beschreibt, die auch zu militärischen Zwecken genutzt werden können. Sie ist von der Initiative nicht betroffen.
Die Initiative verhindert also den Export von Kriegsmaterial in Krisenregionen oder an undemokratische Regierungen. Damit könnten, wenn Abnehmer keine gleich guten Waffen auf dem Markt finden, oder wenn sie für ihr Geld anderswo weniger erhalten, zahlreiche Menschenleben gerettet werden. Andererseits werden dadurch auch Lieferungen an demokratische und vertrauenswürdige Länder, die das Material tatsächlich nur zur Selbstverteidigung einsetzen würden, verhindert.
Argumente
Gegner der Initiative weisen auf mehrere mögliche negative Auswirkungen der Initiative hin:
– Es wird behauptet, die Umsetzung der Initiative würde 10’000 Arbeitsplätze in der Schweiz vernichten. Die ausführliche Studie des BAK im Auftrag des Seco kommt allerdings zum Schluss, dass „nur“ gut 5000 Stellen verloren gehen würden. Tatsächlich ist die Schweizer Rüstungsindustrie in einzelnen Regionen konzentriert (Thun, Kreuzlingen, Stans und Zürich). Die Initiative sieht vor, dass der Bund den strukturschwächeren Regionen unter ihnen während 10 Jahren finanziell bei der wirtschaftlichen Umstellung unter die Arme greift. Dass Konversionen möglich sind, zeigt die SIG in Schaffhausen, die heute keine Waffen mehr herstellt, und die Ruag selber, die heute zur Hälfte bereits zivile Güter herstellt. Wenn angenommen wird, dass Waffenkäufer wegen eines Schweizer Ausfuhrverbotes ihre Käufe teilweise in einem anderen Land tätigen, so werden dort entsprechend zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Für die Menschen, die in der Schweiz ihren Arbeitsplatz verlieren würden, bedeutet dies eine Tragödie. Aber als Christen dürfen wir nicht die Schweizer, also unsere eigenen Arbeitsplätze höher gewichten als diejenigen von Menschen in einem anderen Land. Beide sind vor Gott gleich viel wert.
– Es werden auch gesamtwirtschaftliche Einbussen ins Feld geführt. Selbst im für die Rüstungsindustrie starken Jahr 2008 entfielen allerdings nur 0,33% aller Exporte auf Rüstungsgüter. Volkswirtschaftlich ist die Rüstungsindustrie relativ unbedeutend.
– Als weiterer Einwand wird gesagt, dass durch ein Waffenausfuhrverbot die Schweizer Rüstungsindustrie stark schrumpfen würde. Damit wäre die Weiterentwicklung der Schweizer Waffentechnologie verlangsamt und die Deckung des Ausrüstungsbedarfs der Schweizer Armee aus eigenen Industrien vermindert. Die militärische Unabhängigkeit der Schweiz sei damit nicht mehr gesichert. Allerdings wird bereits heute 70% des Schweizer Armeebedarfs im Ausland beschafft, und bei den Rohstoffen der Rüstungsindustrie sind es gar 100%.
– Vor Allem aber sei der «Aufwuchs» der Armee, also das Konzept der Aufstockung in Zeiten von Sicherheitskrisen, nicht gesichert, denn eventuell könnten ausländische Lieferanten gerade dann auch in Engpässe kommen. Hierzu gilt es allerdings zu sagen, dass heutige Krisen kaum mehr national gelöst werden können. Ausser bei einem unmöglich anzunehmenden Angriff der EU auf die Schweiz würde die Schweiz immer in (wohl inoffizielle) Zusammenarbeiten eingebunden sein, und somit nicht zu kurz kommen. Zudem wäre sie verteidigungstechnisch ohnehin von der EU umgeben. Eine Schweiz, die sich unabhängig gegen alle umliegenden Staaten verteidigen könnte, ist heute mehr denn je eine gefährliche Illusion.
– Durch eine Annahme der Initiative könnten auch Dual-Use-Güter zum Teil nicht mehr ausgeführt werden, denn es herrsche eine Unklarheit, welche Güter betroffen seien. Doch hier gilt die Wassenaar-Liste, die bereits in der EU erfolgreich angewendet wird, als genügend klare Richtlinie. Zudem ist es, auf Grund der bisherigen Erfahrungen, nicht anzunehmen, dass der Bundesrat sich bei Unklarheiten zu Ungunsten der Schweizer Industrie, bzw. für eine harte Linie entscheiden würde.
– Schliesslich könne genau der Waffenexport ein Instrument der Sicherheitspolitik werden, indem «die Richtigen» gestärkt werden. Bisher ist aber keinerlei entsprechende Politik erkennbar, und eine solche ist deshalb auch für die Zukunft nicht anzunehmen.
6. Fazit: Gerechtigkeit statt Angst
Die Schweizer Waffenausfuhren haben in der Vergangenheit viel Leid mitverantwortet. Die letzten Entwicklungen lassen nicht auf grosse Verbesserungen schliessen. Es wird deshalb Zeit, damit aufzuhören, selbst wenn es uns Geld und Arbeitsplätze kostet.
Der Erhalt einer Rüstungsindustrie mit dem vorrangigen Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten, ist aus ethischer Sicht nicht akzeptabel, selbst wenn damit für die Arbeitslosen Leiden verbunden ist. Ihnen muss beigestanden werden. Doch vor Gott sind Menschenleben wichtiger als monetäres Einkommen. Die Einbussen für die Schweizer Wirtschaft wären tragbar, die allfälligen Kosten für die Allgemeinheit ebenso. Lassen wir uns nicht vor der Angst um den eigenen Wohlstand, sondern von Gerechtigkeit leiten.
Ängste vor Verlust der Schweizer Abwehrfähigkeit bei Reduktion der Rüstungsindustrie sind meines Erachtens unbegründet, wenn man die heutige Sicherheitssituation in Europa ansieht: Ohne Multilateralismus geht nichts mehr. Gegner der Initiative scheinen noch in einer Reduit-Mentalität gefangen, mit der mystischen, von nationalistischen Motiven getragenen Idee, die Schweiz als Land mit besonderer Salbung könne sich gegen alle alleine verteidigen. Tatsächlich hat das Sorgenbarometer 2008 der Credit Suisse eine starke Zunahme des Nationalismus in der Schweiz festgestellt. Nationalismus entsteht in Zeiten von starken kulturellen Veränderungen und in Zeiten von Krisen, die Angst hervorrufen. Diese Angst bewirkt ein Suchen von Schutz im grösseren Verband und eine Mystifizierung des Verbands.
Deshalb werden die Initianten auch als Armeezerstörer gebrandmarkt. Tatsächlich ist es für die Sache etwas ungut, dass genau die Gruppe Schweiz ohne Armee eine Initiative für ein Waffenausfuhrverbot trägt. Allerdings müsste von mündigen Stimmbürgern erwartet werden, dass sie die Sache diskutieren und nicht den Überbringer der Sache.




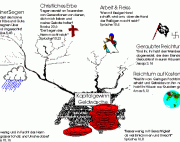





Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!