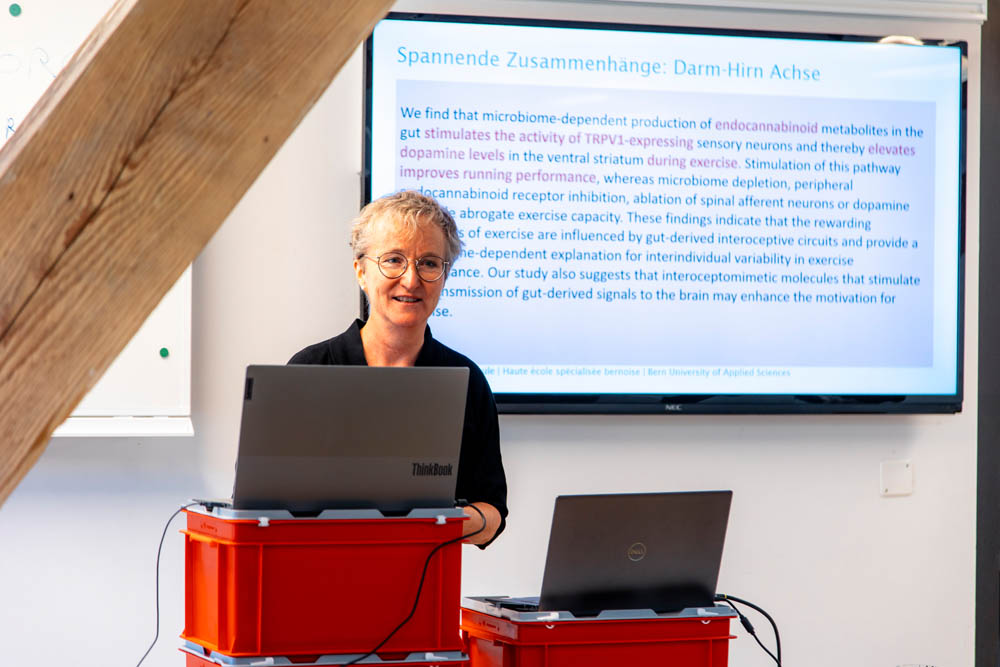~ 5 minWas ist Rassismus genau? Wie können wir ihm im Alltag begegnen? Mark Moser macht zunächst eine Auslegeordnung zu den Begrifflichkeiten und gibt schliesslich praktische Tipps, um «aktiv ein antirassistisches Leben» zu führen.
Rechtes Gedankengut und Rassismus ist in der deutschsprachigen Welt gemäss Studien auf dem Vormarsch. In der Schweiz wurden im Jahr 2022 10 Prozent mehr Fälle von Rassismus beim Schweizer Beratungsnetz gemeldet. Fremdenfeindlichkeit, rechtes Gedankengut und die Kategorisierung von Menschen nach sozialer Klasse, Ethnie, Nationalität und Aufenthaltsstatus ist auch in Kirchen leider nicht unüblich.
Im Kontext des Rassismusdiskurses trifft man inzwischen auf eine Vielzahl an Begriffen. Bezeichnungen wie black facing oder black profiling, aber auch auf Ausdrücke wie racial turn, rassiale Differenz, Intersektionalität, white supremacy oder critical whiteness. Grundlegend ist jedoch zunächst eine Klärung dessen, was eigentlich mit «Rasse» und «Rassismus» gemeint ist. Alltagsrassismus bezieht sich auf «lebensweltliche rassistische Praktiken und deren Erfahrung als auch auf die Inkorporierung von rassistischen Einstellungen im Sinne von Denk- und Handlungsmustern sowie emotionale Reaktionen und Prägungen.»
Im Schweizer Recht umfasst Rassismus jede Form von ungerechtfertigter Ungleichbehandlung, Äusserung oder physischer Gewaltanwendung, die Menschen wegen ihrer Herkunft, Rasse, Sprache oder Religion herabsetzt, verletzt oder benachteiligt.
Soziale Kategorisierung als Grundlage von Vorurteilen
Es gibt ein klassisches Konzept von «Rassismus». Rassistisch sind Ideologien, die die Menschheit in einer Anzahl von biologischen Rassen mit genetisch vererbbaren Eigenschaften einteilen, und die so verstandenen Rassen hierarchisch einstufen.
Weiter verbreitet hingegen ist ein verallgemeinertes Konzept (weite Bedeutung) von Rassismus. Es umfasst Ideologien und Praxisformen auf der Basis der Konstruktion von Menschengruppen als Abstammungs- und Herkunftsgemeinschaften, denen kollektive Merkmale zugeschrieben werden, die implizit oder explizit bewertet und als nicht oder nur schwer veränderbar interpretiert werden.
Diese Definition erweitert den Anwendungsbereich des Ausdrucks «Rassismus» von den biologisch aufgefassten Rassen auf alle Arten von Abstammungsgruppen, die als andersartig dargestellt werden, insbesondere auf «ethnische Gruppen» oder «Völker».
In unserer fragmentierten, hyper-individualisierten Gesellschaft beobachten wir die Auswirkungen von sozialer Kategorisierung. Darunter verstehen wir den mentalen Vorgang, bei dem eine Person jemand anderes oder sich selbst einer sozialen Kategorie bzw. sozialen Gruppe zuordnet. Man sieht eine andere Person oder sich selbst als Frau oder Mann, alt oder jung usw. Es handelt sich um einen automatischen Prozess, der sich praktisch nicht unterdrücken lässt. Zum einen ist soziale Kategorisierung nützlich, weil sie erlaubt, Erwartungen aufzubauen und Handlungen vorzubereiten. Zum anderen ist sie Grundlage für die Anwendung von Stereotypen und Vorurteilen.
Die Sozialforschung zeigt, dass wir zwischen den Gruppen (In-Groups), denen man sich zugehörig fühlt, und den Fremdgruppen (Out-Groups), auf die das nicht zutrifft, differenzieren. Ingroup-Mitglieder sehen einander als Individuen, während wir Outgroup-Mitglieder eher als Gruppe sehen. Forschungen zeigen, dass wir bei der Beurteilung von Personen aus anderen sozialen Gruppen (Out-Groups) weniger empathisch und eher kritisch und mit häufig negativen Assoziationen reagieren.
Rassismus ist mit Nächstenliebe nicht vereinbar
«Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!» Dieses Gebot der Nächstenliebe ist eindeutig, es enthält keinen Spielraum für Diskriminierung und Verfolgung von Menschen. Gott liebt den Menschen: «Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden» (1. Johannes 4,10). Dabei ist seine Liebe uns Menschen gegenüber bedingungslos und gilt allen. Ebenfalls sehr bekannt ist folgende Stelle aus dem 2. Buch Mose: «Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken; denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen» (2. Mose 20, 22). Die Botschaft ist glasklar: Rassismus ist nicht vereinbar mit dem Gebot der Nächstenliebe. Ebenso ist Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nicht kompatibel mit einer Theologie, die von einem liebenden Gottesbild ausgeht.
Rassistische Vorstellungen haben sich Weisse zurechtgelegt, um sich von weissen Nicht-Christen (Juden, Muslime etc.) und von christlichen Nicht-Weissen (z. B. Äthiopier, Kopten, Araber, christianisierte Afrikaner, Latinos etc.) abzugrenzen und sich als Herren über sie zu stellen.
Gerade das Christentum muss seinen Anteil am Rassismus anerkennen, aufarbeiten und ihn mit einem anderen Ansatz überwinden. Auf wissenschaftlicher, aber auch auf literarischer Ebene gibt es in letzter Zeit von Angehörigen der People of Colour hervorragende Schriften, die solche Ansätze und Visionen entwerfen.
Für das Christentum ist «Menschlichkeit» ein Ansatz: Vor Gott sind wir Menschen alle gleich. Menschlichkeit zielt auf Versöhnung hin.
Die Vorstellung, dass Gott im Menschen wohnt und nicht irgendwo weit weg im Weltall, kann ein Weg sein, dass Menschen einander respektvoll behandeln.
«Gott schaut herab vom Himmel auf die Menschen, zu sehen, ob da ein Verständiger sei, einen, der nach Gott fragt» (Psalm 53,3).
Konkret: Wie auf Rassismus reagieren?
Rassismus nicht zu akzeptieren ist eine aktive Lebenshaltung. Ich versuche aktiv anti-rassistisch zu leben. Ich toleriere keine rassistischen und diskriminierenden Aussagen und Handlungen. Ich bin bereit, auf diese zu reagieren. Was ich unbedingt vermeiden will, ist eine Situation, in der ich rassistische Aussagen oder Handlungen schweigend hinnehme. Denn Schweigen wird als Zustimmung, als Akzeptanz verstanden.
Je nach Beziehungs- und Vertrauensgrad, wähle ich eine unterschiedliche Vorgehensweise bei rassistischen und diskriminierenden Aussagen.
Wenn kaum Vertrauen und Beziehung vorhanden sind, erlebe ich es als wenig erfolgsversprechend, eine Haltungsänderung bewirken zu wollen. Dann benenne ich die rassistische oder diskriminierende Aussage und Handlung und grenze mich ab. Wichtig ist es, die Aussagen und Handlungen sichtbar zu machen und allenfalls auch Massnahmen einzuleiten.
Ich bin bereit, meine Ablehnung der Aussage verbal zu äussern und fokussiere auf die Aussagen und nicht auf die Person. Ich versuche, die Aussage nachzuvollziehen und lasse die Aussage verifizieren. «Habe ich dich richtig verstanden? Du sagst …» Dies gibt der Person die Möglichkeit, allenfalls die Aussage abzuschwächen oder sie zurückzuziehen.
Ich versuche nachzuvollziehen, warum die Person diese Aussage in diesem Augenblick macht. Ist es aus Wut, Enttäuschung oder aus dem Affekt? Das entschuldigt die Aussage nicht, hilft aber bei der Einordnung.
Ich setze klare Grenzen mit Aussagen wie: «Ich bin da ganz anderer Meinung und ich distanziere mich in aller Deutlichkeit von dieser Aussage.»
Häufig reagieren Menschen, die rassistische Aussagen machen, mit dem Recht auf freie Meinungsäusserung. Ich verweise häufig auf den gesetzlichen Kontext und die Tatsache, dass Menschen gemäss Schweizer Recht nicht aufgrund ihrer Herkunft, Nationalität usw. diskriminiert werden dürfen und versuche das Gespräch auf Prinzipien und Werte zu lenken.
Gerade weil Religionen Nährböden für rassistische Interpretationen bieten können, ist es besonders wichtig, dass sich Religionsangehörige gegen Rassismus einsetzen.
Als Mensch und Christ bin ich überzeugt, dass Gott der Vater/die Mutter eine liebevolle Gottheit ist. Diese göttliche Liebe gilt entweder niemandem oder allen.
Foto von Markus Spiske auf Unsplash