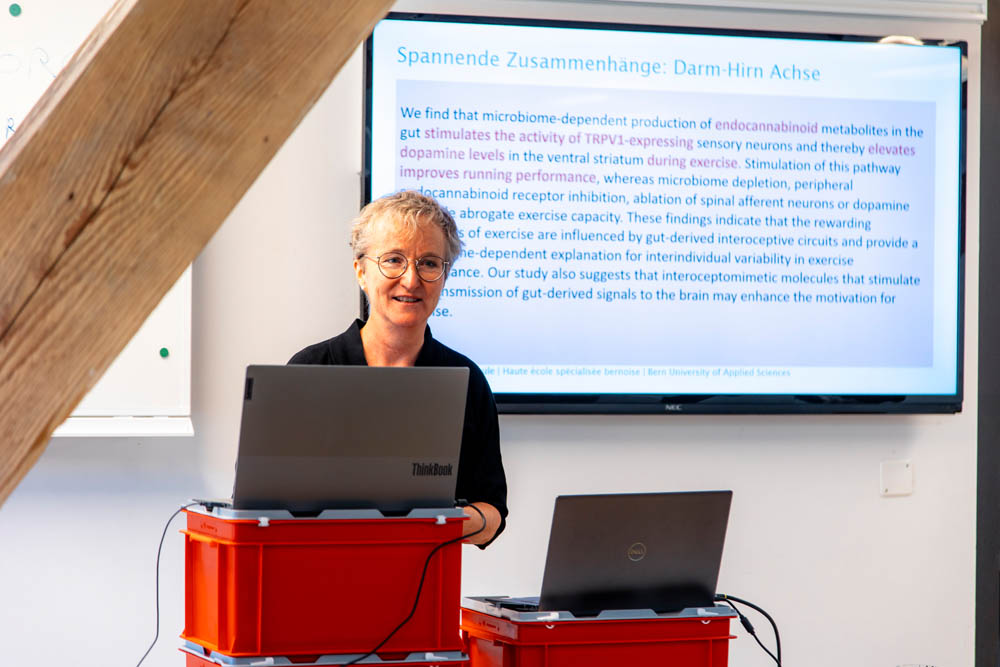Der Arbeitgeberverband fordert, dass wir alle mehr arbeiten sollen, um dem Fachkräftemangel beizukommen. Kann das gut gehen? Und: Brauchen wir das wirklich?
Die «betriebsübliche Arbeitszeit» hat im letzten Jahrhundert stetig abgenommen. Während die Schweizerinnen und Schweizer vor hundert Jahren noch weit über 50 Stunden pro Woche arbeiten mussten, so erreichte die durchschnittliche Arbeitszeit im Jahr 1993 42 Stunden und pendelte sich seit 2003 auf 41,7 Stunden ein. Da könnte man meinen, etwas mehr davon könne ja nicht schaden.
Arbeiten wir wirklich weniger?
Die Trendwende zu mehr Arbeit hat schon länger stattgefunden: Auf Druck der Finanzdienstleister hat Bundesrat Schneider-Ammann auf Anfang 2016 verfügt, dass Arbeitnehmende, wenn sie ein Bruttojahreseinkommen inklusive Boni von mindestens 120’000 Franken haben und weitgehend selbst über ihre Zeiteinteilung entscheiden können (und falls die Firma einem Gesamtarbeitsvertrag untersteht), ihre Arbeitszeit «nicht mehr erfassen müssen». Das heisst in den meisten Fällen, nicht mehr erfassen dürfen – und damit arbeiten müssen «bis fertig». Doch fertig ist selten, denn solange keine Schranken da sind, kann man den Angestellten problemlos noch mehr Aufgaben zuweisen. Hunderttausende von Menschen in der Schweiz arbeiteten schon vorher länger als «betriebsüblich», nun sind noch mehr dazugekommen.
Immer dichter, immer schneller
Hinzu kommt die massiv gestiegene Arbeitsintensität: In den letzten Jahrzehnten fand eine starke Verdichtung der Arbeit statt. Leerzeiten existieren kaum mehr. Immer mehr Menschen arbeiten nur noch im «Notfallmodus». Das Dringliche hat überhandgenommen. Ältere Menschen haben mir schon mehrfach gestanden, dass sie froh sind, nicht mehr arbeitstätig zu sein. Früher hätten sie zwar mehr Stunden gearbeitet, aber dafür schön stetig und «eins nach dem anderen». Heute seien alle nur noch am «seckle».
Dieser Dauerstress kommt nicht von ungefähr: Um den Return on Investment (ROI) – die Kapitalrendite – für die Aktionäre zu optimieren, streichen börsenkotierte Unternehmen regelmässig Stellen. Sie wollen dann die Arbeit auf die verbleibenden Angestellten verteilen. Wenn früher ein ROI von 5 Prozent gut war, müssen es heute 30 Prozent sein. Wir haben uns daran und an die Folgen gewöhnt und finden das einfach normal. Doch dieser Druck «von oben» zwingt in der Konkurrenzsituation auch viele andere Unternehmen zur selben «Kostensenkung», wie etwa die Migros, die innert zwei Jahrzehnten die Anzahl der Angestellten pro Ladenfläche halbiert hat.
Steuersenkungen führen in eine Spirale
Vielleicht auch unter dem Eindruck, dass wir ja hart arbeiten und «der Staat» uns nicht «alles wegnehmen» soll, haben wir in den Kantonen regelmässig weiteren Steuersenkungen zugestimmt, mit der Folge, dass danach auch in den Schulen und Spitälern Stellen gestrichen wurden, sodass der Stress in diesen Bereichen unerträglich hoch geworden ist. Grössere Klassen machen die Arbeit der Lehrkräfte noch schwieriger. Heute wollen sich immer weniger gut gebildete junge Menschen diesen Job antun, in gewissen Fächern herrscht inzwischen Lehrermangel, was wiederum zu grösseren Klassen führt. Und in den Spitälern wird längst vom Pflegenotstand gesprochen. In keiner anderen Branche gibt es so viele Aussteiger: 46 Prozent verlassen laut dem Schweizer Berufsverband für Pflegefachpersonal (SBK) ihren Beruf wieder, ein Drittel vor dem 35. Altersjahr. Oft deshalb, weil sie ausgebrannt sind.
In die Erschöpfung getrieben
Die Folge all dessen ist eine steigende Anzahl Burnouts, die aber momentan nur die Rückversicherungen stört. Zwischen 2012 und 2020 sind die Arbeitsunfähigkeiten auf Grund von psychischen Gründen um 70 Prozent gestiegen. Der Job-Stress-Index zeigt bis 2020 eine stetige Steigerung der Anzahl Menschen, die im kritischen Bereich arbeiten. Rund 30 Prozent der Menschen sind heute emotional eher oder sehr erschöpft. Auch die ständigen Umstrukturierungen und Veränderungen tragen dazu bei.
Wenn der Arbeitgeberverband unter diesen Umständen nun fordert, dass wir noch mehr und flexibler arbeiten müssten, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, dann ist dies hochgradig menschenfeindlich. Damit würden noch mehr Menschen in die Erschöpfung getrieben, und die Schäden müssten nicht einmal die Unternehmen berappen, da der Bundesrat sich ziert, Burnout als Arbeitskrankheit zu anerkennen. Die Gesundheitskosten und IV-Prämien sind auch wegen den Verschleisserscheinungen dieser Menschen gestiegen.
Die Alternative: Mehr Zeit und Beziehungen statt noch mehr «Wohlstand»
Dem «Mangel an Fachkräften» kann nur begegnet werden, indem wir unsere Ansprüche an die weitere Steigerung des Wohlstands zurückschrauben. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir wirklich einen Geländewagen (SUV) brauchen oder ein noch grösseres Heimkino.
Wenn wir weniger Fachkräfte haben, wird unsere Wirtschaft und damit unser Wohlstand tatsächlich etwas weniger schnell wachsen. Ist das wirklich ein Problem? Wir müssen innehalten und uns grundsätzlich die Frage stellen, was wir wirklich brauchen: Noch mehr «Wohlstand» oder ein weniger frenetisches Leben, in dem wir auch Zeit haben, um für unsere Kinder da zu sein oder Raum für die Kontemplation finden. Unter diesem Gesichtspunkt ist es zu begrüssen, dass auch Akademiker Teilzeit arbeiten dürfen und nicht «zur Strafe» die Studienkosten zurückzahlen müssen. Warum sollten deren Kinder ihre Eltern kaum mehr sehen dürfen? Sollen sie in Krippen abgeschoben werden, nur weil die Eltern studiert haben?
Erziehung und Beziehung – das ist die Basis unserer Gesellschaft. Diese Grundtätigkeiten dürfen wir nicht leichtfertig opfern.
Dieser Artikel erschien erstmals am 01. März 2024 auf Insist Consulting.
Foto von Verne Ho auf Unsplash