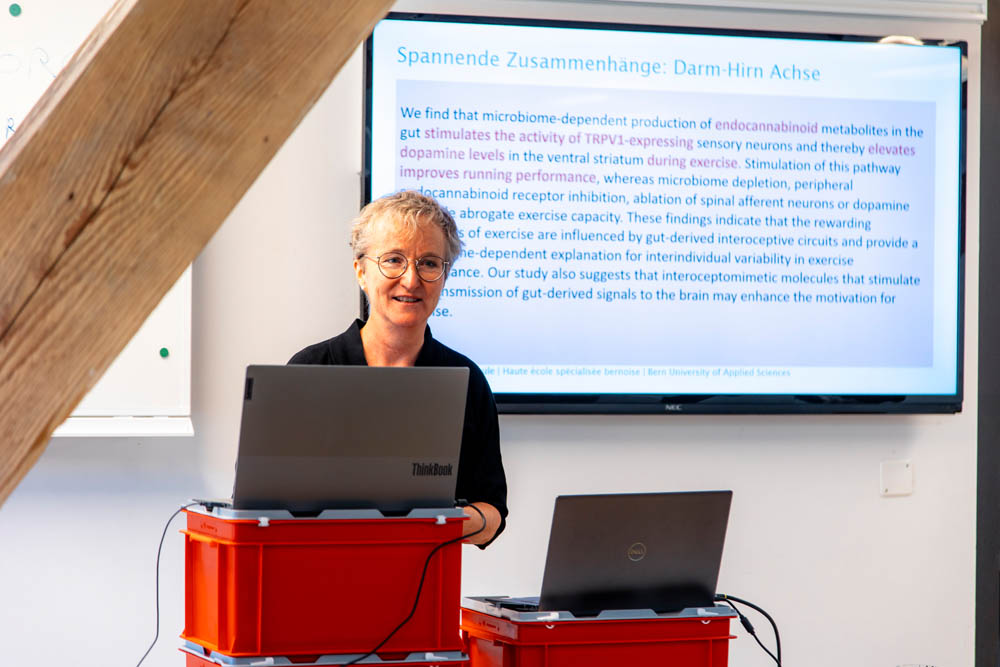Die weltweite Popularisierung des Internets in den 90er-Jahren war eine echte Errungenschaft. Mit E-Mails konnte man plötzlich ganz unkompliziert Freunde erreichen und ihnen Dokumente übermitteln; Websites machten es möglich, die Botschaft der eigenen Firma oder Institution in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. Mit den sozialen Medien, KI und dem Verfälschen von Bildern und Tönen hat diese faszinierende Informationswelt ihre Unschuld verloren. Heute droht eine Desinformationsgesellschaft, die zu einer wachsenden Gefahr für uns alle wird. Gibt es Auswege?
Als Journalist war ich von Anfang an dabei, als das Internet für alle verfügbar wurde. Das Zischen und Surren während des Aufbaus einer Verbindung faszinierte nicht nur mich, sondern auch meine Kinder. Ich führte sie nach und nach in diese faszinierende Welt ein. Anfangs verbunden mit einer strengen Zeitlimite. Wer sich länger im Internet bewegen wollte, musste das mit seinem eigenen Sackgeld bezahlen.
Für das Verbreiten der christlichen Botschaft eröffneten sich auf einen Schlag neue Möglichkeiten, insbesondere in den wenig entwickelten Gebieten unserer Welt. Sobald dort Internetverbindungen verfügbar waren, musste der Missionar nicht mehr zwingend persönlich anwesend sein. Er konnte seine Texte – so etwa Bibelübersetzungen – bequem digital übermitteln. Es wurde möglich, auch im Weltsüden digitale Unterrichtseinheiten für eine breite Bevölkerung anzubieten. Eine schöne neue Informationswelt!
Die Blütezeit von Facebook
Für den Studenten Mark Zuckerberg und seine Freunde war Facebook anfangs nur ein Gag, um den Wettbewerb um hübsche Studentinnen anzuheizen. Er spürte aber rasch, dass mit Social Media mehr möglich war. Schliesslich liess sich das Ganze ja mit Werbung verbinden und damit finanzieren. 2007 war der 23-jährige CEO von Facebook bereits Milliardär. An der Börse gewann das junge Unternehmen immer mehr das Interesse von Kapitalisten. Innert Kürze war Facebook 15 Milliarden Dollar wert.
Anfangs gab es noch keine Like-Funktion, «niemand konnte seinen Selbstwert an den Daumen messen, die von andern geklickt wurden»1 . Auch das unendliche Scrollen gab es noch nicht. Wenn man alle Reaktionen von Bekannten gelesen hatte, war der eingegebene Beitrag – der Post – an seinem Ende angelangt. «Kein Algorithmus steuerte die Beiträge, sie erschienen schlicht in der Reihenfolge, in der sie publiziert worden waren».
Jessica King schildert diese Blütezeit von Facebook so: «Es ging ja auch nicht darum, in eine manipulierte Parallelwelt einzutauchen, in der alle anderen Menschen scheinbar aufregendere Leben führen. Stattdessen benutzten wir die Plattform, um am banalen Alltag anderer teilzunehmen, … Gruppen mit lustigen Namen zu gründen, … sich zum Geburtstag zu gratulieren und die Profile von Menschen zu suchen, die man an der Uni sonst nur von weitem sah. Es war ein Tool, um Verbindungen zu schaffen und zu intensivieren.» Also ein ähnlicher Effekt, der mit der Einführung des Internets eingeläutet worden war.
Der Anfang vom Ende
Am 9. Februar 2009 führte Facebook den Like-Button ein. Jessica King reagierte mit dem folgenden Post: «Wer diesen Beitrag liked, ist doof.» Die Reaktion kam sofort: «Schon klickten mehrere auf das Däumchen, und zum ersten Mal spürte ich den kleinen Dopamin-Rausch der digitalen Zuneigung. Bald brütete ich über der Frage, warum gewisse Posts besser funktionierten als andere, versuchte meine Performance zu optimieren. Ich verglich mich mit anderen und spürte einen leichten Anflug von Scham, wenn ich weniger Likes als Kommilitoninnen und Kommilitonen erzielte.»
Parallel zur Lancierung des Like-Buttons kam Facebook in der Schweiz auf eine Million Nutzer. Nun wurde die Plattform zunehmend gesteuert. Jessica King stellt fest, dass Facebook immer häufiger andere Formate mit ihren eigenen Beiträgen verknüpfte, mit «Werbung, News und Beiträgen bislang unbekannter Seiten, ‚die mir gefallen könnten’». 2011 entschied sich Facebook, die fremden Beiträge nicht mehr chronologisch sondern von Algorithmen gesteuert aufzulisten. Damit begann das unendliche Scrollen auf der Suche nach einem noch spannenderen Beitrag zum Thema. Jessica King schildert ihre Erfahrung so: «Immer länger blieb ich nun am Bildschirm sitzen, scrollte und scrollte und scrollte, in der Welt des blauen Riesen gefangen.»
Mark Zuckerberg begann nun, sein Unternehmen auszubauen. Er schluckte Konkurrenten wie Instagram und Whatsapp und bezahlte dafür 1 bzw. 19 Milliarden Dollar. «Dass Profit immer wichtiger wurde, spürten wir im Alltag», sagt Jessica King dazu. «Versprühte Facebook zu Beginn noch ein karge Ästhetik, wurde die Plattform zunehmend mit knalliger Werbung, verwirrenden Feeds und unkontrollierbaren Sidebars zugekleistert.»
Als sich 2011 der Arabische Frühling entlud, trugen Facebook und der Konkurrent Twitter die Proteste aus Tunesien in alle Welt. Jessica King frohlockt: «Der Glaube an die politische Macht von Facebook wuchs – sogar Diktatoren konnte man damit stürzen! Wir posteten unsere Unterstützung, nutzten ab 2013 dafür Hashtags2 , die Facebook eingeführt hatte, und glaubten, mit diesem digitalen Aktivismus den Unterdrückten der Welt geholfen zu haben.»
2014 wurde das Symbol # in der Schweiz zum Wort des Jahres gewählt. Die wichtigsten Hashtags waren 2014 dann aber nicht Themen rund um die Ungerechtigkeit in unserer Welt, sondern zum Beispiel #IceBucketChallenge. Unter dieser Adresse leerten sich Menschen rund den Globus eiskaltes Wasser über den Kopf und dokumentierten dies mit einem Videoclip, in der Erwartung, möglichst viele Likes zu erhalten. Zu den bekanntesten Hashtags gehört #MeToo, der seit Mitte Oktober 2017 im Zuge des Weinstein-Skandals Verbreitung in den sozialen Netzwerken erfuhr und eine soziale Bewegung für die Rechte der Frauen bei sexuellen Übergriffen auslöste.
Mit den erwähnten neuen Möglichkeiten war die Plattform Facebook aber unkontrollierbar geworden. Missbrauch machte sich breit. Jessica King sagt zur Entwicklung von 20 Jahre Facebook, die Internetplattform habe sich vom lieblichen digitalen Dorf zur Gefahr für Demokratien gewandelt, Mark Zuckerberg vom kindlichen Jungunternehmer zum kaltblütigen Überkapitalisten, der sich vor dem amerikanischen Kongress erklären muss.
Bei Google werden die Daten jeder Suchanfrage aufgezeichnet. «Dazu gehören der Standort, Suchbegriffe, das Suchverhalten und Webseitenklicks», schrieb Debby Blaser im Magazin INSIST. «Auf vielen Webseiten werden die Nutzer ‚verfolgt‘, indem anhand der IP-Adresse aufgezeichnet wird, wer die Webseite besucht hat. Diese Daten machen es möglich, dass mir auf Facebook in einer Werbeanzeige genau der Turnschuh angezeigt wird, den ich mir vor kurzem auf Zalando angeschaut habe. Was praktisch ist für Werbetreibende, empfinden manche Nutzer jedoch als Eingriff in ihre Privatsphäre3 .»
Die asozialen Medien werden zum Tummelfeld für Empörungen
Die sozialen Medien erlauben es den Nutzern, zu allen möglichen und unmöglichen Themen rasch eine Meinung zu bilden und diese dann mit andern zu teilen. Bei grosser Zustimmung wächst die Verbreitung dieser Meinung und kann Prozesse in Gang bringen, die kaum noch zu zügeln sind.
Die Journalistin Alexandra Föderl-Schmid, Nahost-Spezialistin der «Süddeutschen Zeitung», hat kürzlich mutmasslich versucht, sich das Leben zu nehmen. Ihr wurde vorgeworfen, in mindestens drei Fällen Erläuterungen öffentlicher Institutionen im Wortlaut übernommen zu haben, ohne dies entsprechend zu deklarieren. Sie habe damit ein Plagiat abgeliefert – eine Todsünde für Journalisten. Das deutsche Portal «Nius» engagierte darauf den «Plagiatsjäger» Stefan Weber, weitere Plagiate – etwa in der Dissertation der Journalistin – aufzudecken. Weber fertigt gegen Geld Gutachten zu akademischen Arbeiten an. «Webers Analysen bringen regelmässig prominente Personen in Schwierigkeiten», schreibt dazu die Journalistin Raphaela Birrer und fügt hinzu: «Häufig erfolgen allerdings seine Anschuldigungen zu Unrecht.» Für sie geht es bei solchen Debatten und Gutachten «längst nicht mehr um intellektuelle Redlichkeit oder universitäre Standards. Es geht um politische Motive, Rachefeldzüge, Rufmord.»
Die asozialen Medien eignen sich hervorragend, um diese Empörungen zu verbreiten. Obwohl eine Untersuchung zeigte, dass an den Vorwürfen bezüglich der Dissertation von Alexandra Föderl-Schmid wenig dran war, kam es zu Hasskommentaren mit Befürwortungen des Suizidversuchs und geschmacklosen persönlichen Angriffen. Die Meinungen waren schon gemacht und liessen sich durch nichts erschüttern. Raphaela Birrer meint zu den Undifferenziertheiten und zur Empörung im Fall Föderl-Schmid: «Sie liefern unfreiwillig Anschauungsunterricht für die degenerative Entwicklung digitaler Debatten. Und sie verdeutlichen, dass es im Moment schwierig bis unmöglich ist, Diskussionen … nüchtern zu führen. Nicht einmal dann, wenn ein Diskurs fast tödliche Folgen hat4 .»
Künstliche Intelligenz und Hacking verstärken das Problem
Künstliche Intelligenz mag helfen, maschinelle Prozesse schneller zu machen. Wenn sie aber im Internet zum Zuge kommt, droht eine Verschärfung der genannten Probleme. Man füttert KI mit einem Gesicht und einer Stimme. Aus diesen Daten erstellt die KI dann eine Matrix, die als Vorlage für jede weitere Version dient. Im März letzten Jahres sei ein Video mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in Umlauf gekommen, der seine Truppen aufgefordert habe, die Waffen niederzulegen und sich Russland zu ergeben, schreibt Andrian Kreye. Es sei aber sofort klar geworden, «dass jemand seinen Kopf auf einen Rumpf montiert hatte»5 .
In einem anderen Beispiel spricht der Fussballer Lionel Messi an einer Pressekonferenz verständliches Englisch, obwohl er grundsätzlich immer spanisch spricht. Die dahinter stehende Technologie nennt sich Voice-Cloning, die mit Übersetzer-KI vereint wurde. Ein eher harmloses Beispiel.
Wenn Fälschungen (Deepfake) aber dazu gebraucht werden, Nacktbilder des Popstars Taylor Swift in pornografischer Absicht zu generieren, ist das persönlichkeitsverletzend im höchsten Masse. Deepfake-Pornografie wird nicht selten auch zur Erpressung eingesetzt6 .
Womit wir in der untersten Schublade angekommen wären: der Möglichkeit, das Internet zu hacken und so an vertrauliche Daten zu gelangen – sei es um Firmen zu erpressen oder falsche Botschaften zu verbreiten. Diese Hackerangriffe nehmen exponenziell zu, auch in der Schweiz. 2022 gingen beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit des Bundes 34’000 Meldungen zu Cybervorfällen ein, dreimal so viele wie 2020. Laut dem Journalisten Michael Bucher wird für 2025 «eine weltweite Schadenssumme durch Cyberattacken von gegen 11 Billionen Franken prognostiziert. Das wären rund 40-mal höhere Kosten als Naturkatastrophen im Jahr 2022 verursacht haben7 .»
Am kürzlichen Weltwirtschaftsforum in Davos wurden Fake News als grösste Gefahr für die Menschheit in den nächsten zwei Jahren bezeichnet. Falschinformationen im Internet könnten die Gesellschaft weiter spalten. «Mit Technologien wie ChatGPT oder neuen Versionen von Photoshop ist es leicht möglich, Texte zu erstellen oder etwa Bilder zu fälschen»8 . Auf diese Weise können «gezielt gestreute Fehlinformationen anstehende Wahlen in den USA beeinflussen.» Das könnte Zweifel an neu gewählten Regierungen wecken und politische Unruhen auslösen. Eine Gefahr für die Demokratie!
Was können wir tun?
Auf dem Weg von der Information zur Desinformation bleibt die Wahrheit auf der Strecke: wir folgen der Lüge. Der selbstgerechte Laie wird sich darüber nicht weiter aufhalten. Aufgrund der Informationen, die ihm dank seinem Profil zugespielt wurden, weiss er ja, was Sache ist. Damit verbunden ist die wachsende Skepsis gegenüber der Wissenschaft. 2016 stimmten gemäss einer US-Studie 44 Prozent einer breiten Öffentlichkeit der Aussage zu, «Experten sei weniger zu trauen als Laien». Wenn sich aber Laien zu Spezialisten aufschwingen, regiert die Ahnungslosigkeit. «Und was Wahrheit ist, bestimmen im Netz die Lautesten mit der grössten Followerschaft9 .»
Dem Vater der Lüge zu folgen, kann für Christen aber keine Option sein. Was also soll getan werden? Glaubens- und Religionsführer aus Grossbritannien stellten nach einem kürzlichen Treffen über ethische Fragen rund um KI fest, Glaubensgemeinschaften und zivilgesellschaftliche Organisationen müssten als «kritische Wächter fungieren, die sowohl KI-Entwickler als auch die politischen Entscheidungsträger zur Verantwortung ziehen». In einem nächsten Treffen wollen sie eine Kommission ins Leben rufen, «mit dem Ziel, die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz für das menschliche Wohlergehen zu nutzen und gleichzeitig Gemeinschaften vor potenziellem Schaden zu schützen»10 .
Dieser Schutz kann durch Institutionen gewährleistet werden, die demokratisch legitimiert sind. Der SVP-Nationalrat Andreas Glarner setzte gegen seine politische Gegnerin Sibel Arslan von den Grünen ein Fake-Video ein. Wenige Tage vor den letztjährigen Parlamentswahlen veröffentlichte Glarner ein täuschend echtes Video von Arslan auf X und Instagram, das mittels künstlicher Intelligenz erzeugt worden war. In diesem Fake-Video äusserte sie dann Meinungen, die dem Gegenteil ihrer tatsächlichen Überzeugungen entsprachen. Arslan ging vor Gericht. Gemäss einem kürzlichen Urteil des baselstädtischen Zivilgerichtes muss Glarner die Gerichts- und Arslans Anwaltskosten für diesen Fall übernehmen. Sie erwägt zur Zeit als nächsten Schritt eine Strafanzeige gegen Glarner. Diese könnte zum Präzedenzfall für einen neuen Straftatbestand werden, der erst seit dem 1. September 2023 in Kraft ist: für den Strafbestand des Identitätsmissbrauchs11 .
Nur Stunden nach der Terrorattacke der Hamas gegen Israel im vergangenen Oktober kursierten auf der Plattform X manipulierte Fotos und Videos anderer Kriege, es gab darunter sogar Sequenzen aus Videospielen und Aufnahmen von Silvesterfeuerwerk. Nutzer verbreiteten diese Bilder als Stimmungsmache gegen Israel oder gegen Palästinenser. «X, die weltweit grösste Quelle für Echtzeitnachrichten, wirkt in diesen Tagen wie ein Verteilzentrum für irreführende Nachrichten», schreibt dazu Jan Diesteldorf. Die EU will nun X-Eigentümer Elon Musk anklagen, der versprochen hatte, die EU-Regeln für digitale Dienste einzuhalten. Gemäss diesen müsste X «schnell, sorgfältig und effektiv auf Hinweise reagieren, illegale Inhalte löschen und ‚wirksam Risiken für die öffentliche Sicherheit und den gesellschaftlichen Diskurs bekämpfen, die von Desinformation ausgehen’»12 .
«Die klassischen Medien verlieren die Kontrolle über den Nachrichtenzyklus, und Algorithmen scheinen zum Teil falsche und sensationsheischende Nachrichten schneller zu verbreiten», führte Silke Adam, Professorin am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften im vergangenen Herbst an einem Workshop der Uni Bern aus. Sie folgerte daraus: «Desinformation gefährdet unsere Demokratie und kann ein Auslöser sein, dass sich Menschen polarisieren13 .»
Daraus lässt sich schliessen, dass wir die klassischen Medien nicht aus den Augen verlieren sollten, vor allem Medien wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder Radio und die parteiunabhängigen Printmedien. Diese sollten in der Lage sein, Fakten statt Fake zu präsentieren, damit wir uns unsere Meinung möglichst in der Kombination von mehreren Medien zuverlässiger bilden können.
Was oft vergessen geht: KI ist verbunden mit einer Verletzung des Urheberrechtes. Zur Zeit läuft ein Prozess der «New York Times» gegen den KI-Anbieter Chat-GPT. Dieser hatte teils wortgetreue Textkopien als KI-Texte ausgegeben. Gary Marcus, Professor für Neurowissenschaften an der New York University, hat selber mehrere Firmen für KI-Anwendungen aufgebaut. Heute gilt er als Stimme der Vernunft in der KI-Debatte. Er sieht keine raschen Lösungen: «Solange niemand eine neue Architektur erfindet, mit der die Herkunft von generativen Texten oder generativen Bildern zuverlässig verfolgt werden kann, wird es weiterhin zu Rechtsverletzungen kommen14 .»
Immerhin gibt es erste Fortschritte. Wer bei Chat-GPT nach den Grundlagen für eine werteorientierte Dorfentwicklung fragte, erhielt eine Antwort, deren Inhalt mir sehr bekannt vorkam. Wer dieselbe Anfrage bei Copilot eingibt, bekommt ebenfalls Antworten aus den WDRS-Publikationen, diesmal aber mit einer sauberen Quellenangabe und mit Links zu den ursprünglichen Beiträgen, etwa in unserem Forum.
Es steht uns frei, unser Medienverhalten der neuen Lage anzupassen. Debby Blaser weist darauf hin, dass es für Suchmaschinen wie Google Alternativen gibt, die keine Daten aufzeichnen und keine Informationen an Drittpersonen verkaufen, etwa Swisscows oder DuckDuckGo15 .
Die Präsenz von Facebook ist heute am Abnehmen. Aber auch seine Nachfolger und Alternativen sind datentechnisch und im Blick auf den Missbrauch nicht viel besser. Mastodon soll zumindest vom Prinzip her ein deutlich anderes Sozial-Media-Konstrukt sein: Es gibt keinen zentralen Server und damit keinen Besitzer mit bestimmten wirtschaftlichen Interessen und keinen Empfehlungsalgorithmus für den Feed16. Die Messenger App Threema gilt als sicherere Variante von WhatsApp. Sie schützt die persönlichen Daten laut Eigenwerbung «vor dem Zugriff durch Hacker, Unternehmen und Regierungen».
Die digitale Welt orientiert sich heute an Macht- und finanziellen Interessen, auch wenn sie dabei die Wahrheit opfern muss. Das soll uns nicht daran hindern, die positiven Möglichkeiten des Internets zum Verbreiten guter, faktenbasierter Inhalte zu nutzen. Gleichzeitig können wir mithelfen, dass die negativen Tendenzen aufgedeckt und bekämpft werden.
Alles beginnt bei unseren Kindern
Zu guter Letzt: Vielleicht sollten wir auch etwas Abstand zu unseren digitalen Medien gewinnen. Die Neurowissenschaftlerin Maryanne Wolf plädiert für die Neuentdeckung von zwei alten Disziplinen: Lesen und Denken. Digitale Medien gefährden aus ihrer Sicht beides. Die aktuelle Pisa-Studie habe bei 15-Jährigen weltweit einen Trend zu schlechteren Lesefähigkeiten festgestellt.
Deshalb sagt Maryanne Wolf: «Von null bis fünf Jahren sollten Kinder medienmässig von (Bilder-)Büchern umgeben sein, Eltern und Umfeld sollen ihnen jeden Tag vorlesen, Kinder sollen ihre Bücher halten, damit spielen, ja darauf herumkauen! Lesen soll eine interaktive und sinnliche Erfahrung sein.» Bildschirme könne man dann zwischen eineinhalb und fünf Jahren sehr graduell einführen. Sie sollten aber nicht ein Babysitter-Ersatz sein, weder als Ablenkung noch als Belohnung oder Bestrafung. Sobald die Kinder selbst lesen lernen könnten, mache es Sinn, Print und Digital nebeneinander laufen zu lassen, auch zur Unterstützung des Lesens. Mit vielleicht sieben oder zehn Jahren könne dann die Schule die Kinder in die Welt des vertieften Lesens einführen. «Wenn wir nur noch skimmen und Mühe damit haben, Information und Desinformation auseinanderzuhalten, gefährden wir am Ende unser demokratisches Zusammenleben»17 , glaubt die Hirnspezialistin.
Kurz und gut: Vielleicht können wir ja selber wieder mal ein Buch zur Hand nehmen. Neben der Bibel kann es durchaus auch mal ein guter Roman sein – oder ein Sachbuch über Verschwörungstheorien.
1. Da ich mich bisher nicht zum Mitmachen in sozialen Medien verführen liess, folge ich in diesem Teil meist den Gedanken der Journalistin Jessica King in «Der Bund», 12.2.24
2. dt. Gartenzaun mit dem Symbol #
3. Magazin INSIST, April 2018
4. «Der Bund», 13.2.24
5. «Der Bund», 18.9.23
6. «Der Bund», 10.2.24
7. «Der Bund», 21.2.24
8. Anna Lutz im Pro-Medienmagazin vom 10.1.24
9. «Der Bund», 11.12.23
10. Livenet, 14.11.23
11. «Der Bund», 6.1.24
12. «Der Bund», 12.10.23
13. «Der Bund», 20.10.23
14. «Der Bund», 13.1.24
15. Magazin INSIST, April 2018
16. https://www.watson.ch/digital/review/279309107-twitter-alternative-17-gruende-warum-sich-mastodon-auch-fuer-dich-lohnt
17. «Der Bund», 21.12.23
Dieser Artikel erschien erstmals am 01. März 2024 auf Forum Integriertes Christsein.
Foto von dole777 auf Unsplash